Wenn du ein Haus bauen, erweitern oder umgestalten willst, aber dein Vorhaben nicht ganz in den Bebauungsplan passt - dann bist du nicht allein. Viele Bauherren stoßen auf dieses Problem: Die vorgeschriebene Grundstücksbebauung, die maximale Gebäudehöhe oder die Abstandsflächen lassen keine Flexibilität zu. Doch es gibt einen Weg: Abweichungen und Befreiungen vom Bebauungsplan. Diese sind kein Graubereich, sondern ein fest verankerter Teil des deutschen Baurechts. Du kannst sie beantragen - wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst.
Was ist der Unterschied zwischen Ausnahme, Befreiung und Abweichung?
Viele verwechseln die Begriffe. Dabei ist die Unterscheidung entscheidend, denn sie bestimmt, welches Gesetz gilt und wie du vorgehen musst.
- Ausnahme: Steht schon im Bebauungsplan. Wenn der Plan zum Beispiel sagt: „Bei Gebäuden mit Dachgeschossausbau ist eine Abweichung von 0,5 m zur Grundstücksgrenze zulässig“, dann ist das eine Ausnahme - du musst nur nachweisen, dass dein Fall unter diese Regel fällt.
- Befreiung: Wird vom Amt genehmigt, wenn der Bebauungsplan streng ist, aber deine Situation besondere Gründe rechtfertigt. Hier geht es um §31 BauGB. Du musst zeigen, dass die Einhaltung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Härte führt - oder dass deine Baumaßnahme dem Wohl der Allgemeinheit dient, etwa durch dringenden Wohnraumbedarf.
- Abweichung: Bezieht sich auf die Landesbauordnung, nicht auf den Bebauungsplan. Wenn zum Beispiel die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) einen Mindestabstand von 3 Metern vorschreibt, du aber nur 2,5 Meter hast, kannst du eine bauordnungsrechtliche Abweichung beantragen - vorausgesetzt, du beweist, dass die Nachbarn nicht beeinträchtigt werden und die öffentlichen Belange gewahrt bleiben.
Ein Beispiel aus der Praxis: In Graz hast du ein altes Haus in der Innenstadt, das du sanieren willst. Der Bebauungsplan schreibt eine maximale Gebäudehöhe von 8 Metern vor. Dein Dachstuhl ist aber 8,7 Meter hoch - und das ist historisch bedingt. Eine Befreiung ist hier sinnvoll, denn die Höhe ist Teil der baulichen Identität des Viertels. Die Stadt könnte sie genehmigen, wenn du nachweist, dass die Nachbarn nicht verschattet werden und die städtebauliche Gesamtgestaltung nicht verändert wird.
Wann hast du Anspruch auf eine Befreiung?
§31 Abs. 2 BauGB nennt drei klare Gründe, warum eine Befreiung erteilt werden kann:
- Wohl der Allgemeinheit: Du baust eine Flüchtlingsunterkunft, ein Seniorenwohnheim oder bezahlbaren Wohnraum - und das ist dringend notwendig. Die Gemeinde hat hier einen Spielraum, um den sozialen Bedarf über die starren Regeln zu stellen.
- Städtebauliche Vertretbarkeit: Dein Projekt passt trotz Abweichung in die Umgebung. Beispiel: Du willst ein kleines, modernes Anbau-Zimmer an ein Altbauhaus anfügen. Die Vorschrift verbietet Anbauten über 1,5 Meter Höhe - aber dein Anbau ist nur 1,3 Meter hoch, gut integriert und harmoniert mit den Nachbarhäusern. Dann ist die Abweichung städtebaulich vertretbar.
- Unbeabsichtigte Härte: Die Vorschrift führt zu einer Belastung, die niemand beabsichtigt hat. Du hast ein schmales Grundstück von nur 12 Metern Breite. Der Bebauungsplan schreibt 3 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze vor - das bedeutet, du kannst nicht einmal ein Einfamilienhaus bauen. Das ist keine Planung, das ist eine Unmöglichkeit. Hier greift die Härtefallregel.
Seit 2021 gibt es eine wichtige Neuerung: §31 Abs. 3 BauGB erlaubt speziell für den Wohnungsbau Befreiungen, wenn die Gemeinde zustimmt. Das bedeutet: Wenn du bezahlbaren Wohnraum schaffen willst, hast du eine bessere Chance - selbst wenn deine Baupläne nicht perfekt in den Plan passen.
Was brauchst du für den Antrag?
Ein Antrag ist kein Brief, sondern ein offizielles Verfahren. Du musst alles schriftlich und vollständig einreichen - sonst wird er zurückgewiesen, ohne geprüft zu werden.
- Formular: In der Regel ist das „BAB 10“-Formular (in Hessen) oder ein vergleichbares Formular deiner Gemeinde. Du findest es auf der Website deines Bauamts.
- Begründung: Hier musst du konkret erklären, warum du eine Befreiung brauchst. Nicht: „Ich will mehr Platz.“ Sondern: „Die Einhaltung der 3-Meter-Abstandsregel macht die Bebauung des Grundstücks wirtschaftlich unmöglich, da nur noch eine Fläche von 12 m² für ein Gebäude verbleibt.“
- Bauvorlagen: Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Fotos der Nachbargebäude, Ermittlung der baulichen Nutzung, Abstandsflächennachweis, Stellplatznachweis - alles, was das Amt braucht, um zu prüfen, ob deine Abweichung realistisch und vertretbar ist.
- Gutachten (optional, aber empfohlen): Bei komplexen Fällen - etwa wenn es um Schattenwurf, Lärm oder historische Bausubstanz geht - lohnt sich ein Gutachten von einem Architekten oder einem Baugutachter. Es zeigt dem Amt: Du hast das nicht einfach so ausgedacht.
Ein Fehler, den viele machen: Sie schicken nur einen Antrag ohne Belege. Dann bleibt das Amt auf der Strecke - und sagt „nicht hinreichend begründet“. Du musst das Amt dabei unterstützen, deine Argumente zu verstehen.

Wie läuft das Verfahren ab?
Dein Antrag geht an die zuständige Bauaufsichtsbehörde - meist das Bauamt deiner Stadt oder Gemeinde. Dort wird geprüft:
- Rechtliche Prüfung: Passt dein Antrag unter §31 BauGB? Ist die Befreiung möglich?
- Öffentliche Beteiligung: Die Nachbarn werden informiert und können Einwände erheben. Wenn sie sagen: „Das schattet mein Garten“, „Das verändert das Ortsbild“, „Das macht die Straße enger“ - dann wird das ernst genommen.
- Ermessensentscheidung: Hier kommt es auf das Amt an. Selbst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann es die Befreiung ablehnen - wenn es denkt, dass sie zu viele negative Folgen hat.
Die Bearbeitungszeit liegt zwischen 4 und 12 Wochen. In manchen Städten dauert es länger, wenn viele Anträge anstehen. Du kannst dich nach 6 Wochen erkundigen - aber nicht öfter. Drängen bringt nichts.
Wie viel kostet es?
Die Gebühren richten sich nach der Kommunalgebührenordnung. In den meisten Fällen liegen sie zwischen 50 und 500 Euro. Der Preis hängt vom Aufwand ab: Ein einfacher Antrag für eine geringe Abweichung kostet weniger als ein komplexer Fall mit Gutachten, mehreren Unterlagen und Nachbarn, die Einspruch erheben.
Wenn du ein Gutachten brauchst, kommen noch 500 bis 1.500 Euro hinzu - aber das lohnt sich oft. Ein gut begründeter Antrag hat eine deutlich höhere Erfolgsquote.
Was passiert, wenn der Antrag abgelehnt wird?
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Änderung des Antrags: Du passt dein Projekt an - etwa indem du die Höhe reduzierst, den Abstand vergrößerst oder den Bau erst in einem späteren Schritt durchführst. Dann reichst du einen neuen Antrag ein.
- Widerspruch: Du legst formell Einspruch ein. Das ist ein rechtliches Verfahren, das vor dem Verwaltungsgericht enden kann. Hier brauchst du einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht. Die Kosten liegen bei 1.500 bis 5.000 Euro - aber es lohnt sich, wenn du sicher bist, dass deine Befreiung rechtlich zulässig ist.
Ein Fall aus der Praxis: Ein Bauherr in Graz wollte ein Dachgeschoss ausbauen, aber die Höhenbegrenzung ließ es nicht zu. Er reichte einen Widerspruch ein - mit einem Gutachten, das zeigte, dass das Dach seit 1920 so gebaut war und die Änderung nur eine Wiederherstellung war. Das Amt gab nach. Der Schlüssel: Historische Belege und klare Argumentation.
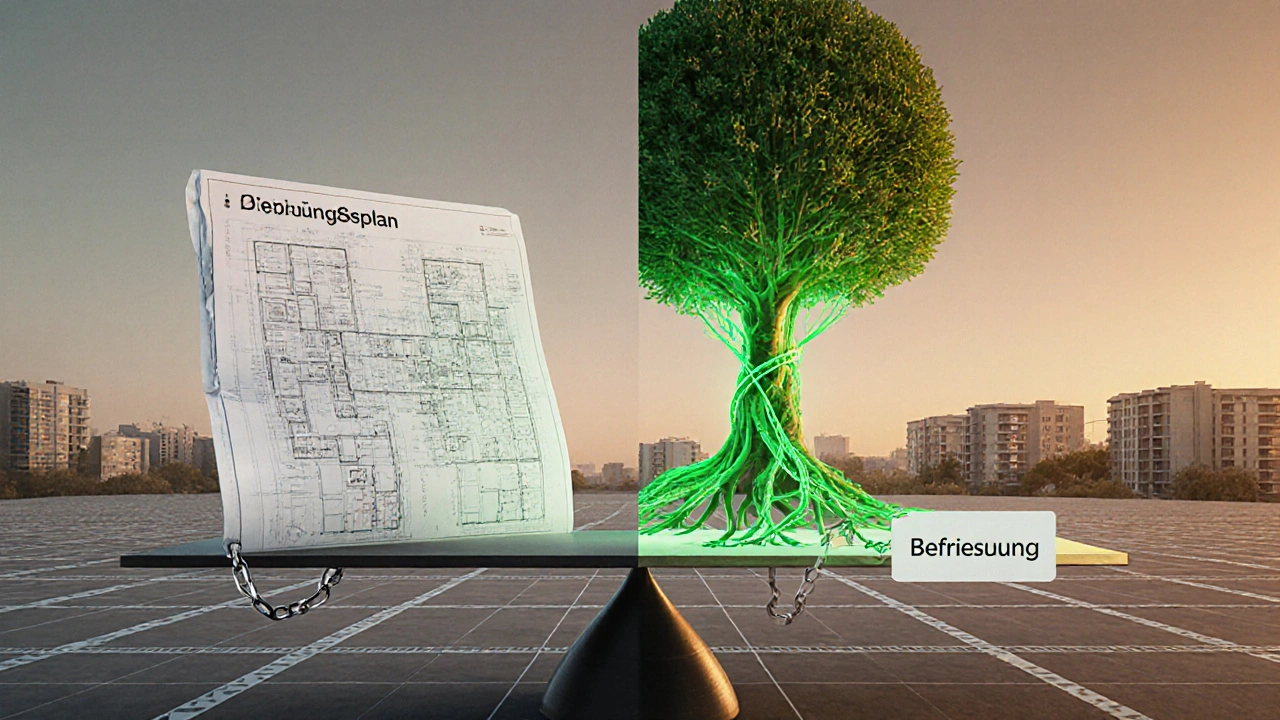
Was sind die häufigsten Gründe für Ablehnungen?
Die meisten Anträge scheitern nicht an der Rechtslage - sondern an der Vorbereitung.
- Keine konkrete Begründung: „Ich brauche mehr Platz“ reicht nicht. Du musst zeigen, warum die Regel in deinem Fall zu einer unzumutbaren Härte führt.
- Nachbarliche Einwände: Wenn Nachbarn ernsthafte Bedenken haben - etwa wegen Schatten, Lärm, Sichtschutz oder Verkehr - dann wird das Amt vorsichtig. Du musst diese Bedenken im Antrag schon ansprechen und wie du sie mindern willst.
- Grundzüge der Planung werden berührt: Wenn dein Antrag die Struktur des Viertels verändert - etwa durch zu hohe Gebäude in einer reinen Wohnzone - dann ist eine Befreiung fast ausgeschlossen. Die Grundzüge der Planung sind unantastbar.
- Unvollständige Unterlagen: Ein fehlender Lageplan, kein Stellplatznachweis, keine Fotos - das ist ein klassischer Fehler. Das Amt kann nicht prüfen, was nicht da ist.
Tipps für einen erfolgreichen Antrag
- Recherchiere vorher: Lies den Bebauungsplan deiner Gemeinde genau. Manche haben schon Ausnahmen für bestimmte Fälle - etwa für Sanierungen in historischen Vierteln.
- Sprich mit dem Amt: Bevor du den Antrag schreibst, vereinbare ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter. Frag: „Was brauchen Sie, um das zu genehmigen?“ Das spart Zeit und Nerven.
- Sei realistisch: Eine Befreiung für ein 12-Meter-Hochhaus in einer 8-Meter-Zone wird nicht funktionieren. Konzentriere dich auf kleine, sinnvolle Anpassungen.
- Dokumentiere alles: Fotos, Briefe, Gutachten - alles, was deine Argumente stützt, wird gebraucht. Sogar alte Baupläne von 1950 können helfen.
- Denke langfristig: Wenn du eine Befreiung bekommst, wird sie im Grundbuch vermerkt. Sie gilt für dein Grundstück - und kann später auch für Nachfolger wichtig sein.
Was ändert sich in Zukunft?
Die Gesetze werden flexibler - besonders für den Wohnungsbau. Die Novelle von 2021 hat den Weg für mehr Befreiungen geöffnet. Gleichzeitig warnen Experten vor einer Überlastung des Systems. Wenn jeder eine Ausnahme will, wird der Bebauungsplan bedeutungslos.
Die Zukunft liegt in Digitalisierung: In Nordrhein-Westfalen kannst du Anträge schon online einreichen. In Graz und anderen Städten folgt man langsam. Bald wirst du deinen Antrag mit einem Klick hochladen - aber die Prüfungsgrundsätze bleiben gleich.
Abweichungen und Befreiungen sind kein „Loch in der Planung“ - sie sind ein notwendiges Ventil. Sie verhindern, dass starre Regeln vernünftige Projekte blockieren. Wenn du sie richtig nutzt, kannst du dein Bauvorhaben realisieren - ohne gegen das Gesetz zu verstoßen.
Kann ich eine Befreiung vom Bebauungsplan auch für einen Carport beantragen?
Ja, aber nur, wenn der Carport eine bauordnungsrechtliche Abweichung erfordert - etwa weil er näher an der Grundstücksgrenze steht, als erlaubt. Ein einfacher Carport unter 3 m² Grundfläche ist oft verfahrensfrei. Wenn er aber über 10 m² ist oder näher als 1 Meter an der Grenze steht, brauchst du eine Abweichung von der Bauordnung. Eine Befreiung vom Bebauungsplan ist nur nötig, wenn der Plan beispielsweise „keine Überdachungen an der Grundstücksgrenze“ vorsieht. In diesem Fall musst du nachweisen, dass der Carport keine städtebauliche Wirkung hat und die Nachbarn nicht beeinträchtigt.
Wie lange gilt eine genehmigte Befreiung?
Eine genehmigte Befreiung gilt für dein Grundstück - und bleibt bestehen, solange du das Gebäude nutzt. Sie wird im Grundbuch vermerkt und geht auf den nächsten Eigentümer über. Wenn du das Gebäude abrissen und neu bauen willst, musst du einen neuen Antrag stellen. Die Befreiung gilt nicht für neue Bauvorhaben, sondern nur für die spezifische Genehmigung, die du erhalten hast.
Kann ich eine Befreiung für eine Solaranlage beantragen, wenn der Dachneigungswinkel nicht passt?
In den meisten Fällen nicht - denn Solaranlagen fallen nicht unter den Bebauungsplan, sondern unter das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Hier gilt: Solaranlagen dürfen auch auf Dächern installiert werden, die nicht optimal ausgerichtet sind. Der Bebauungsplan kann die Installation von Solaranlagen nicht verbieten - es sei denn, es handelt sich um ein Denkmalschutzgebiet. Dann musst du eine Ausnahme vom Denkmalschutz beantragen, nicht vom Bebauungsplan.
Was ist, wenn ich eine Befreiung bekomme, aber die Nachbarn klagen später?
Wenn die Befreiung rechtskräftig erteilt wurde, kannst du bauen - auch wenn Nachbarn später Einspruch erheben. Sie können nur dann erfolgreich klagen, wenn sie beweisen, dass das Amt rechtswidrig gehandelt hat - etwa weil es die Voraussetzungen von §31 BauGB nicht geprüft hat. Ein rechtmäßig erteilte Befreiung ist bindend. Dennoch: Ein gutes Gespräch mit den Nachbarn vorher verhindert oft späteren Ärger.
Kann ich eine Befreiung für mehrere Grundstücke gleichzeitig beantragen?
Ja, wenn die Fälle ähnlich sind - etwa wenn du drei kleine Grundstücke in einer Wohnzone hast und auf jedem ein Dachgeschoss ausbauen willst. Dann kannst du einen Sammelantrag stellen. Das Amt prüft dann gemeinsam, ob die Befreiungen städtebaulich vertretbar sind. Das spart Zeit und Kosten. Aber: Jedes Grundstück muss einzeln dokumentiert werden. Du kannst nicht einfach „alle drei gleich machen“ - jede Lage muss einzeln begründet werden.


Geschrieben von David Loidolt
Zeige alle Beiträge von: David Loidolt